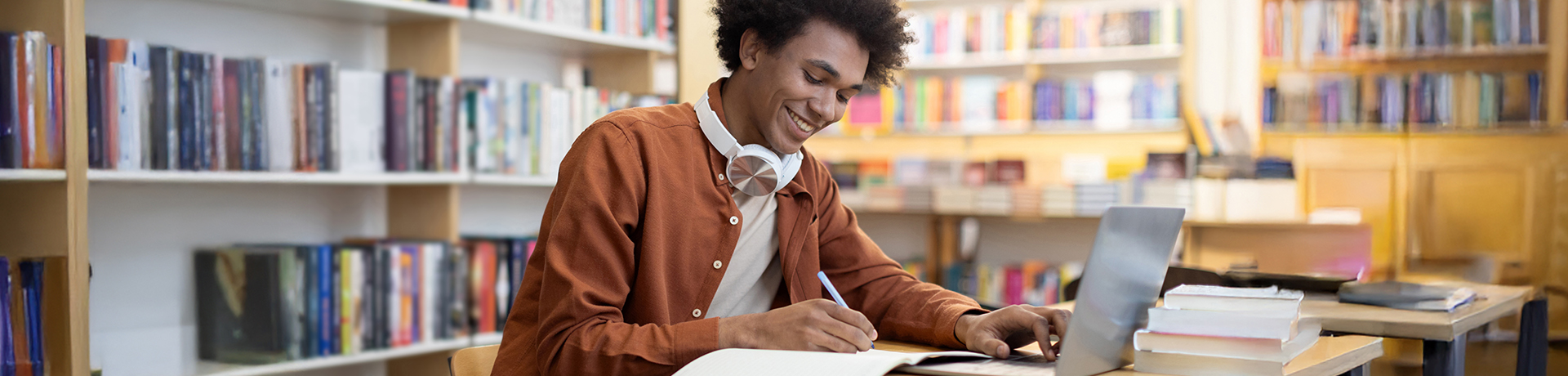Warum Selbstakzeptanz so wichtig ist!
Jede/r von uns hat es wahrscheinlich schon erlebt: Du machst einen Fehler, trittst in ein Fettnäpfchen oder scheiterst an einer Herausforderung – und plötzlich ist da diese innere Stimme, die sagt: »Das hättest du aber besser machen können«.1 Im Uni-Alltag können Gruppenarbeiten und Prüfungen regelrecht dazu einladen, an sich und den eigenen Fähigkeiten oder Entscheidungen zu zweifeln: »Habe ich in der Präsentation genug gesagt? Hätte ich mich in der Diskussion stärker einbringen sollen?« Wenn diese Fragen als Dauerschleife in deinen Gedanken abgespielt werden und das Gefühl verstärken, nicht genug zu sein, kann das ziemlich belasten. Statt sich von Selbstzweifeln bremsen zu lassen, kannst du aber auch einen anderen Weg einschlagen: dir selbst mit Nachsicht begegnen. Warum es sich auszahlt, dich so zu akzeptieren, wie du bist, erfährst du hier!
Fehler gehören zum Leben dazu – wirklich!
In einer Welt voller Social-Media-Highlights und perfekten Lebensläufen kann es leicht passieren, dass wir uns mit unrealistischen Standards vergleichen. Besonders wenn Menschen in unserem Umfeld scheinbar alles richtig machen – etwa die Freundin mit den Bestnoten, der Kommilitone, der souverän präsentiert oder das Geschwisterteil mit der steilen Karriere – zweifeln wir schnell an uns selbst.2 Doch was wir oft nicht sehen: Nicht jeder Lebenslauf verläuft geradlinig. Albert Einstein fiel als Kind in der Schule auf, weil er angeblich zu langsam war. Oprah Winfrey wurde in ihrer frühen Karriere wegen mangelnder Eignung fürs Fernsehen entlassen. Und selbst Michael Jordan wurde in der Highschool aus dem Basketball-Team geworfen. Rückschläge und Fehler sind keine Umwege – sie sind Teil des Weges. Sie helfen uns, unsere Grenzen zu erkennen, Misserfolge einzuordnen und herauszufinden, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Wer Fehler macht, probiert etwas aus. Wer aus ihnen lernt, wächst über sich hinaus.
Von Selbstkritik zu Selbstakzeptanz
Dich selbst ehrlich zu hinterfragen, kann sehr hilfreich sein – vor allem, wenn du daraus etwas lernt. Schwierig wird es nur, wenn diese Gedanken in übermäßige Selbstkritik oder Zweifel abdriften. Eine positive Selbstreflexion funktioniert, wenn du dir Fragen stellt wie:
- Was genau ist schiefgelaufen?
- Was kann ich beim nächsten Mal anders machen?
- Und was habe ich trotzdem gut gemacht?
Der Unterschied zu destruktivem Selbstzweifel liegt darin, dass es dabei nicht um Selbstabwertung geht, sondern ums Dazulernen.3 Ein Beispiel: Du hast eine wichtige Präsentation vermasselt, weil du zu nervös warst. Anstatt dich als »nicht gut genug« abzustempeln, könntest du überlegen, ob du beim nächsten Mal früher mit der Vorbereitung startest oder gezielt an deiner Nervosität arbeitest – etwa durch Atemübungen oder Feedbackrunden mit Freund/innen. Der Schlüssel zu einer konstruktiven Haltung liegt in der Selbstakzeptanz. Das bedeutet, dich selbst auch mit deinen Schwächen anzuerkennen und zu verstehen, dass diese Teil des eigenen Wachstumsprozesses sind. Anstatt dich für Fehler zu verurteilen, nutze sie, um zu wachsen.4
Selbstakzeptanz bedeutet nicht, Fehler zu ignorieren, sondern sie als natürlichen Teil des Lebens anzunehmen und an ihnen zu wachsen. Wenn du dich selbst so annimmst, wie du bist, kannst du mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehen. Und das kann unglaublich befreiend sein. Also: Sei nachsichtig mit dir selbst. Fehler gehören zum Menschsein dazu – genauso wie der Wunsch, manchmal alles richtig machen zu wollen. Du bist wertvoll und das ganz unabhängig von Leistung, Erfolgen oder Schwächen.